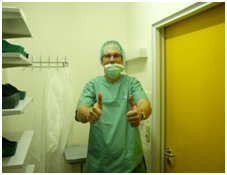Wie ist es, wenn man sein neugeborenes Kind über Wochen nicht in den Arm nehmen kann? Diese Erfahrung machen viele tausend Eltern von Frühchen jedes Jahr. Wochen und Monate des Hoffens und Bangens ersetzen für diese Eltern die Freuden einer „normalen“ Geburt und der anstrengenden, aber schönen ersten Zeit mit dem Baby. Peter Sommer, ein Vater von Frühchen-Zwillingen berichtet von seinen Erlebnissen und Gefühlen rund um die Geburt und die ersten Lebensmonate seiner Kinder. Ein Bericht, der berührt.

Vaterfreude mit kleinen Hindernissen - ein Elternbericht über die ersten Monate mit Frühchen
Eigentlich wollte ich diese Erinnerungen gar nicht mehr zulassen. Gut versteckt sind sie. Verschlossen in einer dunklen Schublade in der hintersten Ecke meines Hirns. Ganz weit hinten, wo ich selbst sie kaum noch zu finden vermag. Gut ist das.
Verstaubt. Aber vielleicht muss man sich einfach häufiger mit den Erlebnissen auseinander setzen,
um zum einen das daraus gelernte Vertrauen aufeinander zu stärken und zum anderen, auch um einfach dankbar zu sein für das, was letztendlich daraus entstanden ist. Ein leichter Weg? Bei Gott,
nein. Das war es wahrlich nicht. Aber beginnen wir am Anfang der Geschichte… Nein, besser für alle wird sein, wir beginnen mittendrin. Im Chaos!
Gerade mal 650 Gramm – ein bisschen mehr als ein Pfund Kaffee
Ich bin Vater von Zwillingen. Mädchen. Selbstverständlich die Besten, die es gibt. Das sagt wohl jeder Vater. Natürlich. Die beiden Zwerge kamen am 10.10.2011 in der 29.+4 Schwangerschaftswoche zur Welt. Für die Männer unter uns: Das bedeutet, dass sie 29 Wochen plus 4 Tage im Körper der Mutter verbracht haben. Wir können uns das ja nie so gut merken mit dieser komischen Berechnung. Da geht es mir nicht anders. Heute, 2 Jahre später, noch nicht. Was ich aber weiß, ist, dass das viel zu früh ist. Viel zu früh. Anna wiegt bei der Geburt 1.230 Gramm und meine kleine, klitze-, klitzekleine Marie gerade mal 650 Gramm. Ein bisschen mehr als ein Pfund Kaffee. Das ist nicht viel. Gar nicht.
 Wir hatten aber auch schon während der Schwangerschaft mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Wir hatten aber auch schon während der Schwangerschaft mit vielen Schwierigkeiten zu kämpfen.
Überstimulation! Wasser im Bauchraum meiner Frau. Mehrfach. Punktierung des Bauchraums. Zu viel Druck auf der Lunge. Erstickungsgefahr. Krankenhaus. Rettungswagen. Uni-Klinikum. Wir hatten den Joker gezogen. Breit grinste er uns an und gab uns all das, was man nicht haben will. Das volle Programm! Einer aus 10.000. Der ganz große Jackpot! Das ging schon viele, viele Wochen vor der Geburt los. Und auch der schwarze Schatten, der, den viele Geschichten mit einer Sense zeigen, auch der war einige Male in ihrem Krankenzimmer zu Besuch. Unerwünscht. Dunkel. Kalt. Aber er war nur da und ging auch wieder. Ich mag ihn nicht.
Die Kinder entwickelten sich weiter. Trotz der vielen Probleme, Medikamente und Behandlungen
bei meiner Frau. Dann, nach einigen Wochen die Hiobsbotschaft: Die Kleine wird nicht mehr ausreichend versorgt, der Großen geht es eigentlich recht gut. Wir mussten uns entscheiden. Eine ganz sicher oder zwei viel zu früh. Unsere Entscheidung war nicht leicht, dafür aber klar und direkt. Niemand wird zurückgelassen. Niemand!
Am Morgen des 10.10.2011 war es dann so weit. Unsere Mädels mussten geholt werden. Es ging nicht mehr anders. Die Geburt verlief eher „ruppig“. Eine Schwester kam und drückte uns die Große an die Wange. Kurz. Nass. Voller Blut. Ich konnte sie riechen. Hatte Tränen in den Augen. Dann war sie auch schon wieder weg. Gleich 5 Spezialisten kümmerten sich um sie. Gleiches Spiel einige Minuten später mit der Kleinen. Marie sträubte sich ganz schön. Wollte noch nicht ans Licht. Wollte noch bleiben. Beide schrien. Krächzten eher. Leise. Ungewohnt. Ich hatte gehört, es wäre ein gutes Zeichen, wenn man was hört. Ich küsste meine Frau, die unter einem grünen, alles verhüllenden Vorhang lag. Zum Glück! Es ging ihr gut. Sie sagte sie fühle sich so leer. Ich verstand, was sie mir sagen wollte. Ich mich auch. Total leer.
Kurz nur durfte ich zu meinen Kindern. Einen kleinen Blick riskieren. Beide lagen in einem offenen Inkubator. Viele Hände kümmerten sich um sie. Gleich zwei Teams von Spezialisten legten Zugänge. Befestigten diverse Kabel. Schläuche. Steckten Geräte an. Beatmeten. Sie alle waren voll konzentriert. „Wie sollen sie denn heißen?“, fragt mich der Chefarzt. „Die Erstgeborene heißt Anna, die Kleine ist Marie.“ Kleine, klitze-, klitzekleine Marie.
Das Leben aus den Fugen
Seit dem war mein Leben vollkommen anders. Aus den Fugen. Absolut keine Routine mehr. Ungewiss waren die Morgen. Man wacht auf und denkt an die Kinder. Denkt an seine Frau. Überlegt, wie es ihnen geht. Ob die Kleinen wohl noch leben. Das mag sich schlimm lesen, aber es ist, wie es ist. Sicherheit ist weit entfernt. Also nehme ich jeden Morgen das Telefon in die Hand und wähle die Nummer meiner Frau. Ein dünnes, müdes „Guten Morgen mein Schatz“ empfängt mich. „Hast Du schon was von den Kindern gehört?“ frage ich. „Nein, habe mich nicht getraut, schon auf der Station anzurufen“. „Soll ich das machen?“ frage ich? „Ja bitte. Ich kann nicht.“ Ich kann es verstehen.
Uns hat sämtlicher Mut verlassen in diesen Tagen. Auch ich kann nicht. Überlege lange. Fasse dann den Mut und wähle die Nummer, die auf der kleinen Visitenkarte vor mir liegt. „Guten Morgen!
Peter Sommer am Apparat. Ich wollte mich einmal kurz nach meinen Töchtern erkundigen“. Stille. „Guten Morgen, Herr Sommer! Ihre Anna hat uns heute Nacht aber gut auf Trab gehalten. Aber die Beiden machen das wirklich ganz prima!“. Durchatmen. Dreimal. Oh Mann. Heute ist alles gut. Wasche mich. Mache das Haus sauber. Packe meine Klamotten und fahre in die Klinik. 30 Minuten. Hörspiele, Hörbücher. Keine Musik und bloß nichts Sentimentales! Ablenkung. Andere Welten. Geschichten. Gedankenlos lasse ich mich berieseln und fahre meinen Weg.
In der Klinik angekommen fahre ich ins Parkhaus. Beton. Kalt. Meistens leer. Ich gehe rüber in das
Krankenhaus und direkt in das Zimmer meiner Frau. Ein Lächeln. Meistens. Das erste am Tag. Meistens sogar das erste echte Gespräch in ein echtes Gesicht. So ein Haus ist ganz schön leer, wenn man auf einmal wieder alleine darin haust. Komisch, früher hat es mich nie so wirklich gestört, alleine zu sein. Wir sprechen kurz über den Abend, die Nacht, den Morgen. Trauen uns kaum, über die Kinder zu sprechen. Gemeinsam gehen wir dann rüber zur Frühgeborenen-Station.
Monitore, Schläuche, Kabel, Inkubatoren
Wir müssen klingeln und vor der Tür warten. Ein freundliches „Ja bitte?“ empfängt uns. Wir sagen unseren Namen, und dass wir unsere Kinder sehen wollen. Ein wieder freundliches „Kommen Sie rein!“ ertönt im Lautsprecher, und wir betreten die Station. Erste Tür. Direkt links können wir unsere Jacken, Uhren, Ringe in kleinen Schließfächern einschließen. Hände waschen bis hoch an den Arm. Alles gründlich desinfizieren. Lieber noch einmal, man weiß ja nie. Dann empfängt uns eine Schwester, führt uns in das Zimmer. Es ist schön warm. Abgedunkelt. Es piept überall. Monitore. Schläuche. Kabel. Inkubatoren. Inkubatoren sehen aus wie große Plexiglas‐ Kisten. Sie sind es auch. Mit 2 Klappen auf jeder Seite, durch die man greifen kann, wenn man seine Kinder berühren möchte. Oder füttern. Oder das Zwerglein sauber machen. All das dürfen wir bei der kleinen Marie noch nicht. Marie wird noch steril gelagert. Anna ist stärker. Größer. Darf schon berührt werden. Rund um diese Plexiglas‐Kisten sieht man viele Kabel und Geräte. Stetig strömt Luft durch einen Schlauch in die kleine Nasenmaske, welche die Gesichter unserer Kinder bedeckt. Abgeklebt sind die Gesichter zudem mit Tape, damit die Maske nicht scheuert. Es hat lange gedauert, bis wir überhaupt erst mal das wahre Gesicht unserer Mädels haben sehen können. Sehr lange. Viel zu lange.
 Wie wird man normalerweise Vater? Das Kind oder die Kinder werden geboren, untersucht und in den Arm der Mutter und/oder des Vaters gelegt? Alle lachen? Freuen sich? Beobachten entspannt
Wie wird man normalerweise Vater? Das Kind oder die Kinder werden geboren, untersucht und in den Arm der Mutter und/oder des Vaters gelegt? Alle lachen? Freuen sich? Beobachten entspannt
und erfreut das liebliche Gesicht des Kindes? Alles weit weg! Nicht erlebt! Wir haben Angst! Angst zu fragen, wie es ihnen geht. Ungewissheit, ob sie es überhaupt schaffen werden. Beide? Wochenlang. Monatelang. Sorgen um die Kinder haben, gehört zum Vater werden dazu, habe ich gehört. Solche
Sorgen? Schönen Dank! Darauf hätte ich gerne verzichtet. Nicht auf die Kinder, keines Falls, aber auf die Sorgen allemal.
Nach den ersten Tagen Eingewöhnungszeit auf der Frühgeborenen-Station wissen wir nun, was passieren wird. Wir haben Zeit, uns unsere Kinder anzusehen. Ihre Bewegungen. Geräusche. Von den Schwestern hören wir jedes Mal, wie gut sie das machen, dass die Ärzte zufrieden mit der Entwicklung sind. Sie brauchen aber weiterhin die Maske, weil sie häufig noch vergessen zu atmen.
Bitte was?! Sie vergessen zu atmen? Ja, das ist aber normal. Sie müssen sich ja daran auch erst gewöhnen. Also gewöhnen wir uns daran, dass, wenn es mal wieder hektisch wird und wild piept, eine Schwester kommt, die Klappen am Inkubator öffnet und sanft den Oberkörper eines der Zwerge leicht und rhythmisch in einer Hand drückt, bis das Piepen aufhört. Ja, der Körper passt in eine Hand. Eine Frauenhand. Häufig kommt das am Tag vor. Viel zu häufig.
Das erste mal känguruhen – das erste mal echte Nähe
Dann, nach einigen Tagen, dürfen wir zum ersten Mal känguruhen. Große Liegestühle werden aufgeklappt. Oberkörper frei, heißt es dann. Eltern sind schön warm und geben diese Wärme nicht nur, sondern auch Nähe. Das ist es, was die Kleinen nun brauchen. Nähe, Wärme, Liebe. Ich lege mich in den Stuhl, lasse mich nach hinten sacken. Eine Schwester öffnet den Inkubator und holt Anna heraus. Nicht ganz leicht, die ganzen Kabel müssen ebenfalls durch eine kleine Öffnung geführt werden. Der Strang, Kabel und Schläuche läuft nun über meine Schulter an meinem Hals vorbei. Es rauscht, weil die Luft durch den Schlauch strömt. Und dann liegt dieser kleine, kräftig und schnell atmende Körper auf meiner Brust. Winzig. Winzig klein. Das erste Mal in meinem Leben liegt meine Tochter ganz nahe bei mir. Ohne eine Scheibe dazwischen. Bei mir. Hilflos greift die kleine Anna zitternd in die Luft, versucht etwas zu fassen. Sie findet meinen Finger. Nein, meine Fingerspitze. Mehr passt nicht in ihre Hand. Mein kleiner Finger. Unglaublich klein.
 So liegen wir zusammen. Beisammen. 2 Stunden oder 3. Ich mit Anna, meine Frau mit der noch viel kleineren Marie. Ich hatte Angst. Wollte nicht Marie. Jetzt noch nicht. Hatte Angst, etwas kaputt zu machen. Aber es ist unglaublich schön. Beängstigend schön. Wir haben kleine Spiegel, die an den Stühlen befestigt sind, und in denen wir die Gesichter sehen können. Okay, die Augen und die Atemmasken, aber das sind nun unsere Kinder. Unsere! Das ist alles noch sehr weit weg, stelle ich fest. Du bist nun Vater! Sehr weit weg. Mir fehlt noch der Bezug. Das muss ich lernen. Unbedingt!
So liegen wir zusammen. Beisammen. 2 Stunden oder 3. Ich mit Anna, meine Frau mit der noch viel kleineren Marie. Ich hatte Angst. Wollte nicht Marie. Jetzt noch nicht. Hatte Angst, etwas kaputt zu machen. Aber es ist unglaublich schön. Beängstigend schön. Wir haben kleine Spiegel, die an den Stühlen befestigt sind, und in denen wir die Gesichter sehen können. Okay, die Augen und die Atemmasken, aber das sind nun unsere Kinder. Unsere! Das ist alles noch sehr weit weg, stelle ich fest. Du bist nun Vater! Sehr weit weg. Mir fehlt noch der Bezug. Das muss ich lernen. Unbedingt!
So gehen die Stunden, Tage und Wochen ins Land. Zum Glück habe ich einen Arbeitgeber, der die
Familie über alles stellt und mir Freiraum gibt. Jeden, den ich brauche. Das ist gut. Das hat nicht jeder. Ich verbringe meine Tage mit meiner Frau und meinen Kindern in der Klinik. Jeden Tag. Nachts fahre ich zurück in das leere Haus. Alles ist still. Kein Piepen. Keine Lämpchen. Stille. Ich versuche, zu verarbeiten, was ich an diesem Tag erlebt habe. Was kommt auf mich zu? Wie geht es weiter? Werden sie es schaffen? Werden wir es schaffen? 1.000 Fragen. Ich schlafe ein. Tanke Kraft.
4 Monate im Krankenhaus – und trotzdem richtig Glück gehabt
 Ganze 4 Monate verbringen wir im Krankenhaus. Jeden Tag sind wir da, teilweise wohnt meine Frau in der Klinik, um stets bei den Kindern zu sein. Einige Tiefschläge erleben wir noch. Klar, dass nicht alles reibungslos läuft. Leistenbruch auf beiden Seiten bei der kleinen Marie. Operation. Ein bis zwei Infekte machen wir auch mit. Viele Entscheidungen, sind zu treffen, von denen man vorher keine Ahnung hat. Bluttransfusion ja/nein? Könnte gefährlich sein. Hilft ziemlich sicher. Das ist wirklich schwierig. Aber wir haben insgesamt wirklich Glück. Richtiges Glück. Es gibt wesentlich schlimmere „Fälle“. Auch um uns herum. Leider. Wir werden stärker. Stehen zusammen, verlassen uns aufeinander. Das funktioniert! Wir sind ein gutes Team, meine große Liebe und ich. Man funktioniert. Man lernt in der Tat, funktionieren zu müssen. Man lernt zu vertrauen auf das, was einem die Ärzte und Schwestern raten, und man lernt gemeinsam mit den Ärzten zu arbeiten und zu entscheiden.
Ganze 4 Monate verbringen wir im Krankenhaus. Jeden Tag sind wir da, teilweise wohnt meine Frau in der Klinik, um stets bei den Kindern zu sein. Einige Tiefschläge erleben wir noch. Klar, dass nicht alles reibungslos läuft. Leistenbruch auf beiden Seiten bei der kleinen Marie. Operation. Ein bis zwei Infekte machen wir auch mit. Viele Entscheidungen, sind zu treffen, von denen man vorher keine Ahnung hat. Bluttransfusion ja/nein? Könnte gefährlich sein. Hilft ziemlich sicher. Das ist wirklich schwierig. Aber wir haben insgesamt wirklich Glück. Richtiges Glück. Es gibt wesentlich schlimmere „Fälle“. Auch um uns herum. Leider. Wir werden stärker. Stehen zusammen, verlassen uns aufeinander. Das funktioniert! Wir sind ein gutes Team, meine große Liebe und ich. Man funktioniert. Man lernt in der Tat, funktionieren zu müssen. Man lernt zu vertrauen auf das, was einem die Ärzte und Schwestern raten, und man lernt gemeinsam mit den Ärzten zu arbeiten und zu entscheiden.
Es gibt noch viele Höhen und Tiefen, die wir in den kommenden Jahren bewältigen werden ‐ müssen! Vater eines oder gleich von zwei oder vielleicht sogar von drei Frühchen zu werden, ist eine echte Herausforderung. Eine, der man sich in genau dieser Situation aber stellen muss. Ein Rückzieher ist
vollkommen ausgeschlossen. Selbstmitleid sollte man gleich zur Seite legen. Ganz weit weg! Dafür ist und bleibt keine Zeit. Das ist auch überflüssig, man spielt einfach nicht mehr die erste Geige. Man hat nun Verantwortung! Echte Verantwortung! Ich für mich musste meinen Focus neu ausrichten. Auf meine Familie einstellen.
Heute sind meine Damen 2 Jahre und 3 Monate alt. Sie machen sich sehr gut. Vieles wird von Tag zu Tag einfacher. Anderes dafür schwieriger. Das wird wohl auch so weiter gehen. So läuft das schon seit Millionen von Jahren. Alles nur eine Phase ‐ Dass ich nicht lache! Gemeinsam lachen wir viel, spielen, bauen Klötzchen‐Türme. Fahren Laufrad und jagen die Katze durch das Haus. Alle zusammen. Alle vier, mit einem Lachen auf den Lippen. Natürlich gibt es auch andere Tage. Ebenso viele. Aber das ist wohl normal. Viele Menschen begleiten uns, helfen und unterstützen. Wir nehmen regelmäßig an der Frühförderung teil, werden vom SPZ begleitet. Wir kennen jeden Osteopathen und Physiotherapeuten in der Umgebung und haben einen guten Draht zu Ärzten und auch noch zu den ehemaligen Schwestern. Wir halten Kontakt zum Bunten Kreis Münsterland e.V. und treffen uns mit andern Frühchen und deren Eltern. Austausch ist also da. Heute.
Was bleibt an Erinnerungen?
 Ich wurde im Nachhinein häufig gefragt, ob ich ganz konkret als Vater Unterstützung gefunden habe. Wenig. Freunde und Bekannte haben sich in dieser Zeit eher zurückgezogen. Aus Umsichtigkeit. Wollten nicht stören. Hätten sie nicht. Bestimmt nicht. Ich kann da auch niemandem einen Vorwurf machen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten hätte. Vermutlich genauso. Heute nicht mehr. Aber heute kenne ich auch die andere Seite, da ist es leicht, so etwas zu sagen. Ich für meinen Teil hätte häufig gerne mal gesprochen. Mich über meine Kinder unterhalten. Alles erzählt, wie großartig sie sind und dass sie jetzt ganz alleine atmen können. Das wollte so recht keiner hören. Ist ja auch nicht leicht, das zu verstehen. Gesprochen haben Ärzte und die Schwestern mit mir. Die hatten auch immer gute Tipps und standen uns zur Seite. Immer. Tag für Tag und Nacht für Nacht. Auch ungefragt. Das ist wirklich gut. Gut, dass es sie gibt!
Ich wurde im Nachhinein häufig gefragt, ob ich ganz konkret als Vater Unterstützung gefunden habe. Wenig. Freunde und Bekannte haben sich in dieser Zeit eher zurückgezogen. Aus Umsichtigkeit. Wollten nicht stören. Hätten sie nicht. Bestimmt nicht. Ich kann da auch niemandem einen Vorwurf machen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich verhalten hätte. Vermutlich genauso. Heute nicht mehr. Aber heute kenne ich auch die andere Seite, da ist es leicht, so etwas zu sagen. Ich für meinen Teil hätte häufig gerne mal gesprochen. Mich über meine Kinder unterhalten. Alles erzählt, wie großartig sie sind und dass sie jetzt ganz alleine atmen können. Das wollte so recht keiner hören. Ist ja auch nicht leicht, das zu verstehen. Gesprochen haben Ärzte und die Schwestern mit mir. Die hatten auch immer gute Tipps und standen uns zur Seite. Immer. Tag für Tag und Nacht für Nacht. Auch ungefragt. Das ist wirklich gut. Gut, dass es sie gibt!
Eher selten schaue ich nochmals durch die vielen Bilder von vor 2 Jahren. Sehe meine Frau auf dem
Känguruh-Stuhl liegen. Mit vielen Kabeln und Schläuchen, die unter der Decke hervorkommen die eine meiner Tochter wärmt. Sehe die Geräte und Lichter und Inkubatoren daneben stehen. Sie reckt den Daumen in die Luft. Voller Zuversicht. Dieses ist wohl das symbolische Bild für diese Zeit. Für uns. Unser Team. Wir packen das!
Dann kommen sie wieder hervorgekrochen, die Erinnerungen. Kleine Körper, die schnell atmen. Winzige Hände, die ins Leere greifen. Stumme Schreie. Das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Ein kleiner Mensch, der schreit, ohne wirklich zu schreien. Schalllos. Hilflos. Ganz schrecklich. Dann brennen sie wieder, meine Augen. Meine Mundwinkel zucken und ich versuche, mich auf etwas anderes zu konzentrieren. Noch ein paar Jahre, dann wird alles besser sein. Vergessen sein. Negative Erinnerungen verblassen schneller, die guten bleiben länger. Und das ist auch gut so. Bestimmt!
Dieser Artikel erschein ursprünglich in in der Ausgabe 01/2014 des Magazins "Frühgeborene" des Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“ e.V. Wir danken sowohl dem Autoren Peter Sommer als auch dem Bundesverband herzlich, dass Sie uns die Erlaubnis gaben, diesen Beitrag auf vaterfreuden.de noch einmal zu veröffentlichen. Mehr zu Familie Sommer, Anna und Marie gibt es hier zu lesen.